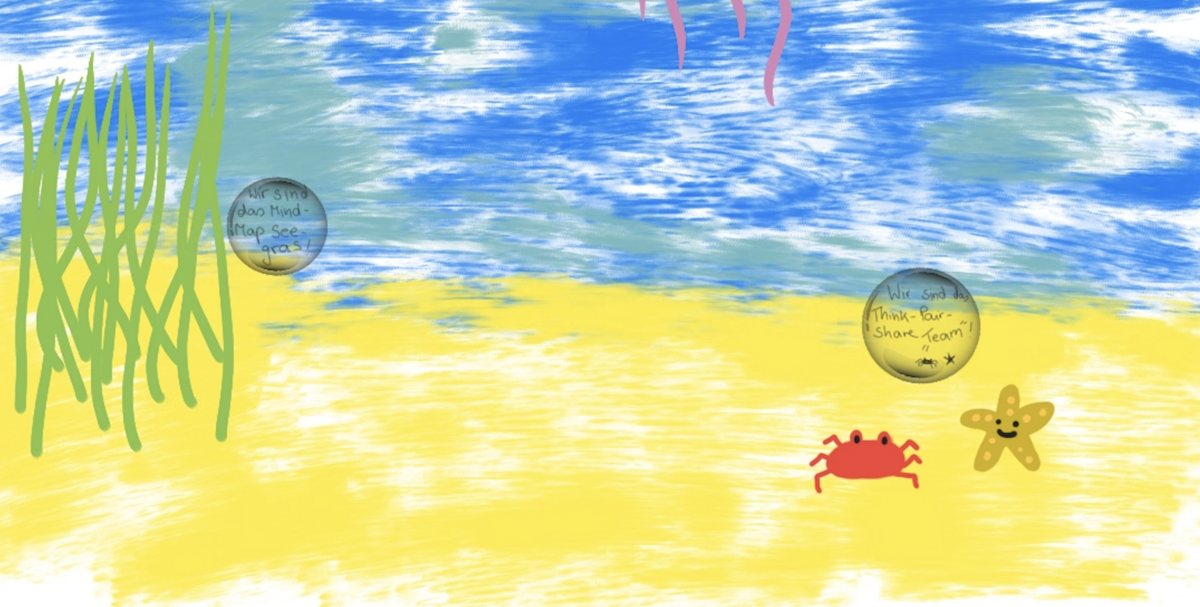MethodenMEER
Sammlung von Lehr- und Unterrichtsmethoden durch Studierende der Universität Greifswald
Unterrichtsmethoden in der Schule: Vielfältig lehren – wirkungsvoll lernen
Klingt vertraut? Der Lehrer oder die Lehrerin spricht, die Klasse schweigt und du hoffst, dass die Uhr schneller tickt. So sieht leider noch viel Unterricht aus. Dabei geht es auch anders – und vor allem besser! Gute Lehre braucht mehr als nur guten Willen. Sie braucht die richtigen Methoden! Unterrichtsmethoden sind das kreative Werkzeug für lebendigen, spannenden Unterricht und es ermöglicht Lehrkräften, den Unterricht abwechslungsreich, zielgerichtet und motivierend zu gestalten. Auf dieser Seite erfährst du, wie du als Lehrkraft aus dem klassischen Frontalunterricht ausbrichst und deine Schüler*innen mit gezielten Methoden zum Mitdenken, Mitmachen und Mitlernen bringst. Dabei findest du eine Sammlung von Unterrichtsmethoden, warum sie wichtig sind und wie sie altersgerecht bzw. klassengerecht sinnvoll eingesetzt werden können – für mehr Lernerfolg und Freude am Lernen.
Die vier "W"s der Unterrichtsmethoden
Was sind Unterrichtsmethoden?
Unterrichtsmethoden sind unterschiedliche Wege, wie Lehrkräfte Wissen vermitteln und den Lernprozess gestalten. Sie reichen von klassischen Erklärungen bis hin zu interaktiven Übungen und helfen dabei, den Unterricht mit Abwechslung und lernförderlich zu entwerfen.
Warum braucht man Methoden im Unterricht?
Methoden sorgen für eine klare Struktur im Unterricht und unterstützen gezieltes Lernen. Sie helfen nicht nur dabei, Inhalte zu vermitteln, sondern fördern auch wichtige Fähigkeiten wie Kreativität, Selbstständigkeit und kritisches Denken.
Wie setzt man Methoden sinnvoll ein?
In der Grundschule stehen spielerisches Lernen, Experimente und kreative Aufgaben im Vordergrund. So lernen Kinder mit Freude und entdecken Inhalte aktiv. In höheren Klassen eignen sich Methoden wie Projekte, Diskussionen oder Fallanalysen, um selbstständiges Arbeiten und tiefes Verständnis zu fördern.
Was tun, wenn es (noch) nicht klappt? - Mögliche Herausforderungen und Lösungen/Tipps
Viele Lehrkräfte sind unsicher, wenn es um den Einsatz von Unterrichtsmethoden geht. Oft liegt das nicht am fehlenden Willen, sondern an ganz konkreten Hürden. Hier zeigen wir die drei häufige Stolpersteine und wie du sie in der Zukunft überwinden kannst:
„Ich erkenne keinen Mehrwert“.
Manchmal fühlt es sich so an, als würde der Einsatz einer Methode zwar für Abwechslung sorgen, aber keinen wirklichen Unterschied im Lernerfolg machen. Der Gedanke: „Das hätte ich auch frontal erklären können”.
Wichtig zu wissen: Methoden wirken oft erst mit etwas Zeit und Wiederholung. Wenn du sie regelmäßig nutzt, können sie ihren vollen Nutzen entfalten. Gleichzeitig gilt: Nicht jede Methode passt zu jeder Klasse. Vertraue deinem Gefühl und finde heraus, was für dich funktioniert.
„Das ist mir alles zu aufwendig“.
Viele Methoden wirken auf den ersten Blick kompliziert oder zeitintensiv. Doch das muss nicht sein.
Die Lösung: Wähle Methoden, die ohne viel Material oder Vorbereitung auskommen. Einige Methoden sind einfach umzusetzen – für dich und für deine Schüler*innen.
„Ich weiß nicht, welche Methode zu mir passt“.
Zwischen all den Ideen, Listen und Begriffen fällt es oft schwer, den Überblick zu behalten. Dabei stellt man sich Fragen wie: „Welche Methode bringt wirklich etwas oder was ist für meine Klasse geeignet”?
Unser Tipp: Fang klein an. Du musst nicht alle Methoden kennen – wichtig ist, dass du ein paar passende findest, die zu dir, deinem Unterrichtsstil und dem Inhalt passen.
Nicht jede Methode ist automatisch ein Erfolg – aber mit der richtigen Auswahl und etwas Geduld kann sie deinen Unterricht bereichern. Du brauchst keine perfekte Planung, sondern den Mut, Neues auszuprobieren und deinen eigenen Weg zu finden.
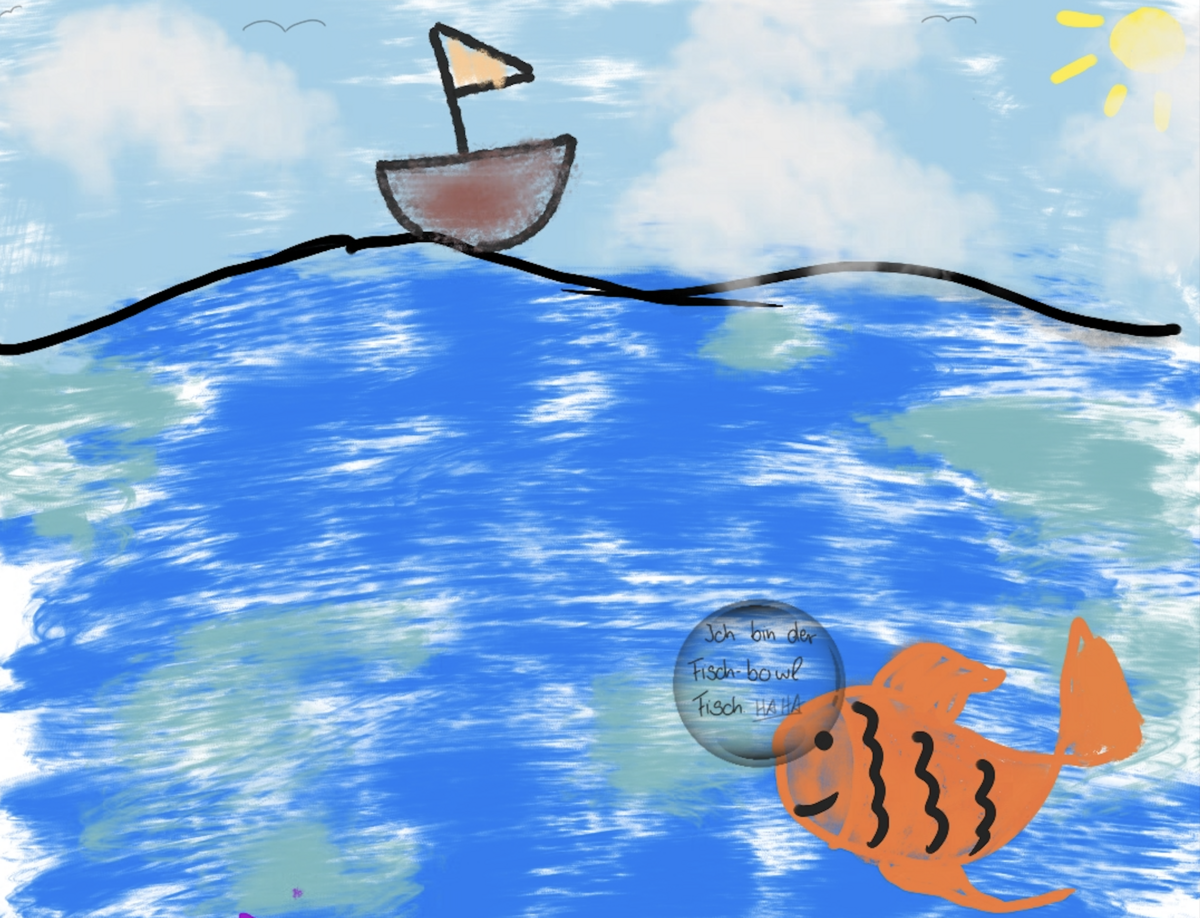

Unterrichtsmethoden als Teil einer handlungsorientierten Stunde
Was müssen Methoden leisten können?
Methoden strukturieren den Lernprozess: Sie teilen ihn in Phasen, geben eine sinnvolle Abfolge vor und unterstützen so planvolles, zielgerichtetes Lernen. Doch sie sind mehr als nur Mittel zum Zweck – sie sind selbst Teil des Bildungsziels. Gute Methoden ermöglichen es Lernenden, Kompetenzen zu erwerben, die weit über den Unterricht hinausreichen: praktisches Können, reflektiertes Handeln, selbstständiges Denken. Sie vermitteln nicht nur Wissen, sondern auch Lernfreude, Selbstwirksamkeit und Leistungsbereitschaft – zentrale Voraussetzungen für ein erfolgreiches (Lebens-)Lernen.
Gibt es gute und schlechte Methoden?
Eine „gute Methode“ ist keine Frage des Trends, sondern der Wirkung. Sie fördert das Lernen, passt zum Ziel, ist organisatorisch realisierbar und wird von allen Beteiligten als sinnvoll erlebt. Dabei sind die Perspektiven unterschiedlich:
- Lehrkräfte achten auf Machbarkeit und Effektivität.
- Lernende erleben Methoden als gelungen, wenn sie Erfolg, Freude und Sicherheit vermitteln.
- Eltern nehmen Methoden positiv wahr, wenn ihre Kinder gerne zur Schule gehen.
Problematisch wird es, wenn neue, potenziell wirksame Methoden gar nicht erst ausprobiert werden – aus Unsicherheit, Skepsis oder mangelnder Unterstützung. Dabei sind viele „neue“ Methoden wie Mindmapping, kooperatives Lernen oder Erschließungsverfahren keine modischen Spielereien, sondern praxiserprobte Werkzeuge, die auf aktuelle Herausforderungen wie Heterogenität, Sprachförderung oder Kompetenzorientierung sinnvoll reagieren.
Was macht die kooperativen Methoden so wertvoll?
Kooperative Methoden kombinieren individuelles Denken mit gemeinsamen Lernprozessen. Jeder Schülerin erhält zunächst die Gelegenheit, sich selbstständig mit dem Thema auseinanderzusetzen, bevor ein Austausch in der Gruppe erfolgt. So wird individuelles Lernen gestärkt – ohne soziale Isolation. Diese Form des Lernens fördert nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch Teamfähigkeit, Empathie und Selbstorganisation – Fähigkeiten, die in einer zunehmend vernetzten Welt an Bedeutung gewinnen.
Wie tragen Methoden zur Individualisierung Differenzierung bei?
Zunehmende Heterogenität im Klassenzimmer ist Realität – und eine Herausforderung, auf die Lehrkräfte mit innerer Differenzierung reagieren müssen. Dabei geht es nicht darum, für jede*n ein eigenes Curriculum zu schreiben, sondern Methoden so einzusetzen, dass sie unterschiedliche Lernvoraussetzungen, Tempi und Interessen berücksichtigen. Das kann durch variable Aufgabenformate, differenzierte Materialien oder die Wahl des Lernprodukts geschehen – immer mit dem Ziel, allen Lernenden gerecht zu werden, ohne sie zu vereinzeln. Die folgenden Unterschiede um Lernverhalten der Schüler stellen für uns die besonderen Herausforderungen dar:
"Die Schüler lernen
1. mit unterschiedlicher Motivation, 4. mit unterschiedlichen Lerninteressen,
2. mit unterschiedlicher Disziplin, 5. mit unterschiedlichem Vorwissen."
3. mit unterschiedlichem Lerntempo und Leistungsvermögen,
(Mattes, Wolfgang: Methoden für den Unterricht. Kompakte Übersichten für Lehrende und Lernende. 2021.)